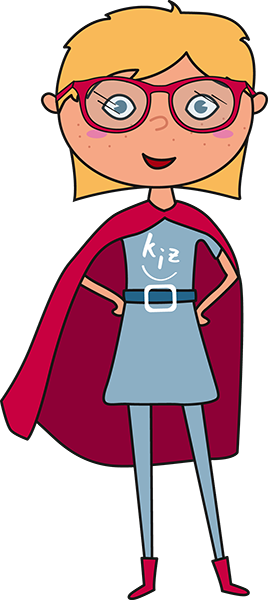Ferdinand Wagner

Bei dieser orthopädischen Kinderkrankheit kommt es zu einer Durchblutungsstörung des Hüftkopfes.
Der Morbus Perthes nimmt typischerweise einen stadienhaften Verlauf (Kondensationsstadium, Fragmentationsstadium, Reparationsstadium und Endstadium). Der Grad der Ausheilung der Patienten im Endstadium wird üblicherweise nach Stulberg klassifiziert (normale Hüfte bis hin zu völlig inkongruentem Hüftgelenk).
Der Verlauf bis zum Wiederaufbau des Femurkopfes beträgt in der Regel mindestens zwei Jahre, die Diagnostik und Therapie orientieren sich an diesem komplexen, sehr langfristigen, stadienhaften und häufig unterschiedlichem Verlauf.
Die definitive Ursache der Krankheit ist unbekannt. Pathophysiologisch findet eine lokale Durchblutungsstörung im Bereich des Hüftkopfes statt, welche je nach Ausmaß verschieden große Läsionen im Bereich des Hüftkopfes verursacht. Die üblichen Klassifikationssysteme orientieren sich daran (Catterall, Salter und Thompson, Herring).
Ein wichtiger, initialer Grund einer Vorstellung ist meistens Schmerz, welcher sich manchmal ins gleichseitige Kniegelenk projiziert sowie Auffälligkeiten im Gangbild.
Das Arbeitspferd der Diagnostik stellt hierbei das Röntgen dar, zu beachten ist hierbei, dass erste radiologische Veränderungen frühestens vier Wochen nach Symptombeginn (leichte bis mäßige Hüftschmerzen, leichtes Schon- und Versteifungshinken, Einschränkungen der Beweglichkeit der betroffenen Hüfte sowie Einschränkungen der Abduktion und die Innenrotation) sichtbar sind.
Radiologische und klinische Verlaufskontrollen erfolgen in der Regel unabhängig von der Behandlung (operativ oder konservativ):
Klinische Kontrollen alle drei Monate (vor allem Prüfung der Beweglichkeit), eventuell auch unterstützt durch Ultraschalluntersuchung; Röntgenkontrollen erfolgen initial alle sechs Monate während zwei Jahren nach Erkrankungsbeginn, anschließend (je nach Befund) nur noch jährlich bis zur Normalisierung, bei Wachstumsabschluss erfolgen nochmalige Röntgenbilder.
Diagnostik mittels MRT, Szintigramm oder ähnlichem spielen aktuell beim Morbus Perthes lediglich eine untergeordnete bzw. keine Rolle.
Sollte sich aufgrund insuffizienter Behandlung oder aufgrund eines sehr fulminanten, schweren Krankheitsverlaufes ein hochgradig pathologischer Umbau des Hüftgelenkes zum Scharniergelenk vollzogen haben, kann eine operative, gelenkerhaltende Therapie nicht mehr suffizient durchgeführt werden. Das heißt, die Gesamtbeweglichkeit des Hüftgelenkes muss vor einer Osteotomie gut sein, diese kann in aller Regel durch eine Operation nicht verbessert werden, eine suffiziente Zentrierung der Hüfte ist bei schlechter Beweglichkeit nicht möglich.
Bei schlechter Beweglichkeit oder röntgenologisch ungünstigem Verlauf stehen verschiedene, sogenannte salvage procedures (Rettungsversuche) zur Verfügung wie zum Beispiel eine Verschmälerung und Konturierung des Hüftkopfes (bump resection - Kopfreduktionsosteotomie nach Ganz) oder eine Neuausrichtung des Oberschenkelhalses zum Hüftgelenk (intertrochantäre Valgisationsosteotomie), welche meistens jedoch nur eine Kompromisslösung darstellen und im funktionellen Outcome ungünstig sind.
Morbus Perthes Konservative Behandlung
Die Therapie des Morbus Perthes verfolgt vor allem das Ziel, die Beweglichkeit (überwiegend konservativ) und das Containments (der Überdachung des Hüftkopfes im Hüftgelenk) zu verbessern.Morbus Perthes Operative Behandlung
Die Verbesserung des Containments wird aktuell überwiegend chirurgisch geleistet, es wird hier im Rahmen sehr individueller Einschätzung der Situation, der zugrunde liegenden Pathologie sowie ggf. vorliegender, weiterer Diagnosen ein Behandlungsplan erstellt (von konservativer Containmentbehandlung mit oft jahrelanger Abduktionsorthesenbehandlung und Lagerungselementen wird bei uns bei in der Regel bei aktiven, gut sozialisierten Kinder größtenteils abgesehen).Das physiotherapeutische Ziel besteht hauptsächlich darin die Beweglichkeit des Hüftgelenkes zu erhalten bzw. zu verbessern und in der Verbesserung des Containments (ein in der Hüftpfanne runder, zentrierter Hüftkopf). In der Abspreizung in Kombination mit Innenrotation findet der Hüftkopf die beste Stellung in der Hüftpfanne, deshalb werden Übungen in dieser Bewegungsrichtung durchgeführt. Es kommen Techniken aus der Manuellen Therapie (Traktion), passive Maßnahmen (Dehnung und Detonisierung) und aktiv/assistive Übungen zum Einsatz.
Im weiteren Verlauf erfolgen kräftigende Maßnahmen der hüftumgreifenden Muskulatur.
In der Entlastungsphase des Hüftgelenks wird das Gehen an Gehstützen bzw. am Rollator geschult.
Das Übungsprogramm soll täglich zu Hause weitergeführt werden, deshalb werden die Patienten bzw. Begleitpersonen intensiv angeleitet.
Da der Krankheits- und Ausheilungsprozess langwierig ist, muss die physiotherapeutische Behandlung zu Hause über Jahre begleitend erfolgen.












Ob Fragen über Behandlungsmöglichkeiten, Terminvereinbarungen oder Informationen über unsere Fördermöglichkeiten - wir beraten Sie gerne!